Kurs auf Cloud

von Philipp Grätzel
In David Mitchells Jahrhundertroman „Cloud Atlas“, grandios verfilmt von dem deutschen Regisseur Tom Tykwer, sind die Wolken eine Chiffre für das sich ewig ändernde menschliche Leben – das aber trotz aller unvermeidlichen und individuell kaum zu beeinflussenden Veränderungen Konstanten kennt, die über Jahrhunderte hinweg bestehen.
Auch in der Digitalisierung steht der Begriff „Cloud“ für etwas, das einerseits neu ist, andererseits aber auch gar nicht. Cloud-Anwendungen sind Software-Programme, die nicht vor Ort installiert sind, also zum Beispiel auf einem Praxiscomputer. Sie befinden sich irgendwo außerhalb, in den Weiten des digitalen Weltraums, in der „Cloud“. Das ist das Neue daran. Aber am Ende ist eine Cloud-Anwendung dann doch wieder nur ein Stück Software, das sich von einem vor Ort installierten Programm funktionell oft kaum, oder auch gar nicht, unterscheidet.
Cloud: Begriffsklärung
Technisch umfasst der Begriff „Cloud“ unterschiedliche Arten von mehr oder weniger modernen IT-Architekturen, für die Begriffe wie „Private Cloud“, „Public Cloud“, „Rechenzentrumsbetrieb“, „Single-/Multi-Tenant-Installation“ oder „Software as a Service“ im Umlauf sind. Auch der Begriff „Managed Services“ wird im Cloud-Kontext gern genutzt. Im Kasten dröseln wir diese Begriffswelt ein wenig genauer auf.
Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer sieht eine Cloud-Anwendung letztlich immer gleich aus, egal welche Architektur, welches Betreibermodell genutzt wird. Auch die Anforderungen aufseiten der Praxis unterscheiden sich nicht. Das Entscheidende ist: Die jeweilige Software ist nicht in den Räumen der Arztpraxis installiert, nicht „On-Premise“, wie IT-Expertinnen und IT-Experten das nennen, also nicht „auf dem eigenen Anwesen“. Ähnlich wie zum Beispiel bei Online-Shops wird der Rechner vor Ort lediglich als Zugriffs-Client genutzt, der sich über eine sichere Verbindung – in den meisten Fällen ein Virtual Private Network, ein VPN – mit der Cloud-Software verbindet. Die Praxissoftware kommt dann quasi aus dem Internet.
Die Cloud hat einige Vorteile
Cloud-Anwendungen kommen im durchdigitalisierten Alltagsleben immer häufiger zum Einsatz. Nicht nur Webshops, auch die Office-Suite von Microsoft gibt es als Cloud- Anwendung. Social-Media-Plattformen sind Cloud-Anwendungen, bestimmte Arten von Computerspielen ebenso. Die Liste ließe sich fortsetzen. Doch wie ist das im medizinischen Umfeld, speziell in der Arztpraxis? Brauche ich das, oder kann das weg? Wer als Praxisleitung die Praxissoftware als Cloud-Installation nutzt, hat im Wesentlichen drei Vorteile:
- Die Software ist immer aktuell. Um die Updates kümmert sich der Hersteller bzw. IT-Dienstleister, niemand muss dafür in die Praxis kommen und Installationsarbeiten verrichten.
- Auch um die Datensicherung muss sich das Praxisteam nicht selbst kümmern. Sie erfolgt in den Rechenzentren der Cloud-Anbieter.
- Zudem geht ein erheblicher Teil der Verantwortung für die IT-Sicherheit, also die Abwehr von Cyberangriffen, auf den IT-Anbieter bzw. den Cloud-Betreiber über.
Auch die mobile Nutzung der Praxissoftware ist beim Cloud-Betrieb einfacher als bei einer Installation vor Ort. Zudem ist häufig ein Zugriff unabhängig vom Betriebssystem und vom genutzten Endgerät möglich. Diese kurze Auflistung zeigt schon, worum es beim Thema vor allem geht – nicht um den genauen Speicherort, sondern um das Drumherum. Der Betrieb der Praxissoftware außerhalb der Arztpraxis ermöglicht es dem Software-Hersteller, eine ganze Reihe an IT-bezogenen Services anzubieten, die bei einer Installation in der Praxis nicht ohne Weiteres möglich wären – schon deswegen nicht, weil dort viele Computer nachts noch ausgeschaltet werden.
Abgesehen von Updates, Datensicherung und Cybersicherheit hat das Thema Cloud durch den Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI) noch eine weitere Dimension bekommen. KI-Anwendungen werden für die Medizin immer wichtiger – derzeit vor allem bei administrativen Prozessen sowie bei der Dokumentation, künftig aber auch vermehrt in diagnostischen und therapeutischen Zusammenhängen. Diese neuen KI-Anwendungen sind flexibler als bisher genutzte Algorithmen, sie lernen mit und benötigen teils erhebliche Rechenkapazitäten. Aus all diesen Gründen sind KI-Anwendungen – nicht nur in der Medizin – mehrheitlich Cloud-Anwendungen. Auch von dieser Seite gibt es also einen Trend hin zur Cloud.

Keine Hardware mehr vor Ort?
Was bedeutet eine Praxissoftware aus der Cloud jetzt konkret für die IT-Ausstattung vor Ort in der Arztpraxis? Brauche ich wirklich jenseits der lokalen Zugriffs-Clients – also der Arbeitsplätze – keinerlei Hardware mehr? Hier gilt es, etwas genauer hinzusehen. Beim Cloud-Betrieb wird der Server, auf dem in der Arztpraxis die Praxissoftware installiert ist, durch einen externen Server im Rechenzentrum bzw. „in der Cloud“ ersetzt. Die Arztpraxis benötigt diesen leistungsstarken Server für die Praxissoftware dann nicht mehr vor Ort. Sie muss ihn auch nicht alle paar Jahre erneuern oder erweitern, wie das bei den typischen Arztpraxis-Servern sonst der Fall ist. Insgesamt sinkt die Komplexität der Praxis-IT, der Administrationsaufwand wird geringer.
Bei einer Cloud-basierten Praxissoftware spart sich die Praxis außerdem einige lokal installierte Hardware-Komponenten, die für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) nötig sind. Dies gilt insbesondere für den Konnektor, der über ein Rechenzentrum zur Verfügung gestellt wird. Die demnächst verfügbaren Highspeed-Konnektoren sind auch noch schneller. Cloud bedeutet hier also nicht nur weniger Hardware, sondern auch mehr Leistung. Allerdings können die zentralen Highspeed-Konnektoren von lokal installierter Praxissoftware genutzt werden.
Nicht verzichtet werden kann derzeit auf die Kartenlesegeräte in den Praxen. Diese Hardware ist weiterhin nötig, auch wenn sich das irgendwann durch die Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur in Richtung TI 2.0 ändern dürfte.

Das Kreuz mit der Medizintechnik
Aber noch mal zurück zu den Servern. Eine rein sprechende Praxis – also beispielsweise eine psychotherapeutische Praxis – kann tatsächlich weitgehend Server-frei betrieben werden, wenn sie sich für einen Cloud-Betrieb der Praxissoftware entscheidet. Vor Ort ist dann nur noch der lokale Zugriffs-Client – ein Rechner, ein Laptop oder auch ein Tablet – nötig, außerdem Kartenleser, ein Router für den VPN-Tunnel und eventuell ein Drucker.
Anders sieht es in Praxen aus, in denen nicht nur gesprochen wird, sondern auch technische Medizin stattfindet. EKG, Geräte zur Lungenfunktionsmessung, das Ultraschall-Equipment können nicht einfach in die Cloud verschoben werden. Diese Geräte und die dazugehörigen Software-Lösungen sind weiterhin vor Ort nötig, und sie sollen in vielen Fällen mit der Praxissoftware kommunizieren. Was das für die digitale Infrastruktur bedeutet, ist sehr individuell. „Grundsätzlich kann man nicht davon ausgehen, dass sich Medizingeräte einfach an eine Praxissoftware in der Cloud andocken lassen“, sagt Nicole Geiße-Dorn, Abteilungsleiterin bei medatixx und dort mit zuständig für das Thema Cloud.
In Einzelfällen geht das schon, etwa wenn ein modernes, DICOM-fähiges Ultraschallgerät direkt in ein Cloud-basiertes Archivsystem speichert. Das sei aber nicht die Regel, so Geiße-Dorn. Meist müsse individuell geklärt werden, welche Schnittstellen das jeweilige medizintechnische Gerät unterstützt. In manchen Fällen braucht es für den Zugriff auf die Daten der Medizingeräte bestimmte Browser-Plug-ins. Und für die Datenspeicherung kann ein eigener Server nötig werden, vor allem, wenn mehrere Medizingeräte im Einsatz sind. Dieser „Geräte-Server“ ist dann zwar kleiner und günstiger als der normale Server, aber er erfordert dennoch Wartung plus Maßnahmen zur Herstellung von Cybersicherheit.
„Cloud-Software ist günstiger“ – Wirklich?
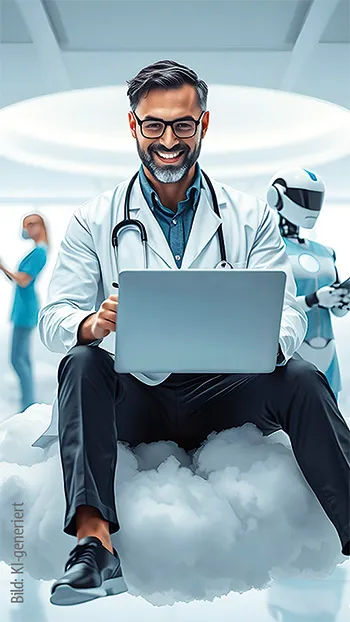
Wie sieht es mit den Kosten aus? Die Kosten von Cloud- und On-Premise-Installationen zu vergleichen, ist nicht ganz einfach. Es gibt eine Menge Variablen, die Einfluss nehmen. Wie häufig wurde der Praxisserver bisher erneuert? Wie groß war der Server bisher? Ist Medizintechnik vorhanden, und muss entsprechend trotz Cloud-Software weiterhin eine Server-Infrastruktur lokal vorgehalten werden? Wie viel Geld wurde bereits in IT-Sicherheit vor Ort gesteckt? Gab es bisher einen IT-Dienstleister, und wird der künftig noch benötigt?
Prinzipiell gilt, dass bei einer Praxissoftware aus der Cloud die Hardware-Kosten sinken und die Lizenz- und Nutzungsgebühren steigen. Sie steigen deswegen, weil die Rechenkapazitäten, die vorher vor Ort vorgehalten wurden, jetzt im Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden müssen. Ist trotz Cloud-Praxissoftware weiterhin ein IT-Service vor Ort nötig, wie das in größeren Arztpraxen und solchen mit Medizintechnik in der Regel der Fall sein wird, dann werden die IT-Kosten in der Gesamtbetrachtung durch den Cloud-Betrieb eher höher werden und nicht sinken. Die Arztpraxis bekommt dafür mehr Komfort und zusätzliche Sicherheit. Die oben geschilderten Services in Bereichen wie Datensicherung, Cybersicherheit, Updates und TI-Anbindung sparen Zeit und Nerven. Das ist vielen den einen oder anderen zusätzlichen Euro wert.
Und wie ist das mit dem Datenschutz?
Cloud-Speicherung von sensiblen Patientendaten – ist das in Deutschland überhaupt erlaubt? Die Antwort darauf ist ein klares Ja. Mittlerweile, muss man einschränkend hinzufügen, denn zumindest in einigen Bundesländern haben Datenschützer bzw. die Landesgesetzgeber lange Zeit darauf bestanden, dass medizinische Einrichtungen Patientendaten nur vor Ort speichern dürfen. Das ist vorbei. Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die deutschen Datenschutzgesetze geben den Rahmen vor. Wer sich daran hält, muss in Sachen Cloud-Speicherung datenschutzrechtlich keine Befürchtungen haben.
Zu den Vorgaben, die die regulatorischen Behörden für den Cloud-Betrieb von IT-Systemen machen, die mit sensiblen Daten hantieren, gehören Zertifizierungen. Die beiden wichtigsten sind die ISO 27001-Zertifizierung und C5-Zertifizierung. Die ISO 27001 bescheinigt dem Rechenzentrumsbetreiber die Implementierung und Zertifizierung eines modernen Informationssicherheitsmanagementsystems. C5 wiederum ist ein spezifischer Compliance-Katalog für sicheres Cloud-Computing, der gesetzlich vorgeschrieben und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ausformuliert wurde.
Perspektivisch wird die C5-Zertifizierung die maßgebliche Zertifizierung für Cloud-Anbieter sein, die mit sensiblen Daten hantieren. Für eine Übergangsphase gibt es derzeit noch Äquivalenzregelungen, bei denen eine ISO 27001-Zertifizierung ausreicht, wenn weitere Kriterien erfüllt sind. In jedem Fall sollten sich Ärztinnen und Ärzte, die eine Cloud-Praxissoftware nutzen wollen, bei ihren jeweiligen IT-Anbietern bzw. -Dienstleistern nach den entsprechenden Zertifizierungen erkundigen.
Interview: „Absolut zufrieden“
Die allgemeinmedizinische Praxis Mazen Khader in Neukirchen-Vluyn betreibt seit Kurzem ihre Praxissoftware im Cloud-Betrieb. Praxismanager Dominik Geiße berichtet über die ersten Erfahrungen und gibt Tipps für den Umstieg auf die Cloud.
Und was ist, wenn das Internet streikt?
Eine Sache lässt sich nicht wegdiskutieren: Wer eine Cloud-basierte Praxissoftware nutzen will, braucht eine funktionierende und hinreichend leistungsfähige Internetverbindung. Das ist heute in den allermeisten Fällen gegeben. Tatsächlich sind Stromausfälle mittlerweile mancherorts häufiger als Internetausfälle. Aber diese Erkenntnis hilft natürlich nicht weiter, wenn doch mal ein Bagger die Glasfaserleitung trifft.
Solchen seltenen Situationen kann durch geeignete Notfallszenarien vorgebeugt werden, wenn die jeweilige Praxis das wünscht. Zum Beispiel ist denkbar, die lokalen Clients mit kostengünstigen Mobilfunkkarten auszustatten, die im Falle eines Kabel-GAUs die VPN-Verbindung per Handynetz herstellen. Dafür braucht es dann einen IT-Servicepartner vor Ort, insbesondere wenn Router genutzt werden sollen, die die Netzwerkverbindung ständig überprüfen und gegebenenfalls automatisch auf die Mobilfunkkarten umswitchen.
Cloud-Software: Ja oder nein?
Fazit: Vor der Entscheidung, ob eine Praxissoftware lokal oder als Cloud-Installation betrieben werden sollte, stehen Arztpraxen immer häufiger. Insbesondere junge Praxisgründer fragen bei den Praxissoftware-Anbietern mittlerweile nahezu regelmäßig nach den Möglichkeiten eines Cloud-Betriebs. Die größte Flexibilität bieten dabei Praxissoftwarelösungen, die sowohl einen On-Premise-Betrieb als auch einen Cloud-Betrieb unterstützen.
Am Ende handelt es sich um eine sehr individuelle Entscheidung. Sie hängt von äußeren Faktoren wie der Internetverbindung – medatixx empfiehlt mindestens 100 Mbit Download und mindestens 40 Mbit Upload mit maximal zehn Prozent Abweichung – und der medizintechnischen Infrastruktur der jeweiligen Praxis ab. Einfluss hat aber auch die Persönlichkeit der Praxisleitung. Es gibt Menschen, die ihre IT ganz bewusst selbst managen möchten. Der On-Premise-Betrieb bietet dafür die nötigen Spielräume. Andere wollen sich um IT-Sicherheit, Datensicherung, Updates und Hardware so wenig wie möglich selbst kümmern. Hier spricht dann – leistungsfähige Internetverbindung vorausgesetzt – sehr vieles für einen Cloud-Betrieb.
So macht es medatixx
Die Praxissoftwarelösungen von medatixx können grundsätzlich sowohl vor Ort installiert als auch in Cloud-Szenarien genutzt werden. Vor allem die Praxissoftware medatixx eignet sich aufgrund ihrer technologischen Architektur sehr gut für den zentralen Betrieb. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass der Ort der Installation einer Praxissoftware eine individuelle Entscheidung der Ärztin oder des Arztes sein sollte, und dass es Aufgabe des IT-Herstellers ist, die individuelle Präferenz optimal umzusetzen und zu unterstützen. Schon heute werden die unterschiedlichen Praxissoftwarelösungen von medatixx in einigen Fällen – insbesondere in MVZ – durch fremde IT-Dienstleister im Rechenzentrumsbetrieb zur Verfügung gestellt.
medatixx selbst betreibt ein eigenes Rechenzentrum für den zertifizierten Cloud-Betrieb seiner Praxissoftware medatixx, um auch eigenen Kundinnen und Kunden den Cloud-Betrieb als Option anbieten zu können. medatixx ist ebenfalls ISO 27001-zertifiziert, was unterstreicht, dass höchste Informationssicherheitsstandards eingehalten werden. Derzeit wird der Cloud-Betrieb bei einigen Nutzerinnen und Nutzern der Praxissoftware medatixx umfassend erprobt und getestet. Natürlich können auch MVZ-Kunden, die sich für die neue MVZ-Software xentro entscheiden, wählen, ob sie eine lokale Installation oder ein zentrales Hosting bevorzugen.
Der Artikel erschien erstmals am 26. Juni 2025 im x.press 25.3.
