Gesundheitspolitik: Der Plan steht

Von Phillip Grätzel
Rund 100 Tage nach Antritt der neuen Bundesregierung gibt es bei der Gesundheits- und Digitalpolitik mehr Fragezeichen als eindeutige Wegweiser. Sicher, eine der ersten Amtshandlungen von Schwarz-Rot war die Stabilisierung des Gesundheitsfonds. Dazu gab es aber auch keine Alternative. Darüber hinaus orientieren sich alle, denen die Zukunft des Gesundheitswesens am Herzen liegt, an einer 144 Seiten starken Absichtserklärung: „Das steht doch so im Koalitionsvertrag“ – das ist im Juli 2025 immer noch der häufigste gesundheitspolitische Satz im Berliner Regierungsviertel.
Dass sich die neue Regierung gesundheitspolitisch schwertut, hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass Gesundheitsministerin Nina Warken, CDU, keine Gesundheitspolitikerin ist. Sie muss sich einarbeiten. Dazu gehört auch die personelle Ausgestaltung des Ministeriums. Der für die E-Health-Politik entscheidende Posten ist die Leitung der Abteilung Digitalisierung und Innovation – ein Posten, den in den vergangenen Jahren Dr. Susanne Ozegowski innehatte. Ob das so bleibt, ist offen, Ozegowski ist in Elternzeit.
Die gesundheitspolitische Großwetterlage
Als x.press-Magazin interessiert uns primär die E-Health-Politik, aber die bewegt sich natürlich nicht im luftleeren Raum. Drei wesentliche Rahmenbedingungen werden die neue Legislaturperiode gesundheitspolitisch prägen. Eine davon hat sich niemand ausgesucht, nämlich die weiterhin sehr angespannte Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Fragt man Menschen, die schon länger in der Gesundheitspolitik unterwegs sind, dann gehen die wahlweise 20 oder auch 30 Jahre zurück, wenn nach Referenzperioden für die aktuelle Situation gefragt wird.
Vor gut 30 Jahren gab es unter Gesundheitsminister Horst Seehofer, CSU, die bisher größte Gesundheits- und Finanzierungsreform im deutschen Gesundheitswesen, das Gesundheitsstrukturgesetz. Es brachte Budgetierungen und vielfältige Zuzahlungen und prägt das deutsche Gesundheitswesen bis heute. Genug war es nicht: Vor 20 Jahren war es Ulla Schmidt, SPD, die erneut handeln musste. Das war die Zeit der Herausnahme weiter Teile des Zahnersatzes aus dem Leistungskatalog, die Zeit der Praxisgebühr und der Gründung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in seiner heutigen Form.

Primärarztsystem und Krankenhausreform
Stärker als in früheren Krisen versucht die Gesundheitspolitik sich in der aktuellen Krise an strukturellen Reformen. Konkret an zweien, und das sind, neben dem Kostendruck, die beiden anderen Rahmenbedingungen der E-Health-Politik in der neuen Legislaturperiode. Zum einen – „steht doch im Koalitionsvertrag“ – will Deutschland ein Primärarztsystem einführen. Wie das genau aussehen soll, ist unklar. Ob das Kernproblem – überlange Wartezeiten bei Fachärztinnen und Fachärzten – sich durch oft heute schon überfüllte Hausarztpraxen lösen lässt, ebenfalls.
Trotzdem werden dem Primärarztsystem gute Chancen auf Umsetzung eingeräumt, weil es von vielen Akteuren prinzipiell begrüßt wird. Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben in einem Positionspapier skizziert, wie Haus- und Kinderärzte sowie Gynäkologen künftig steuern könnten und wie eine Optimierung der 116117-Plattform aussehen könnte. Aus der Steuerung ausgeklammert werden sollen Augenheilkunde und Psychotherapie. Der direkte Facharztzugang soll – so stellt die KBV sich das vor – möglich bleiben, wenn zugezahlt wird. Premiumversorgung zu Premiumpreisen quasi.
Die zweite strukturelle Rahmenbedingung der neuen Legislatur ist ein Erbe der Ampelkoalition: nämlich Karl Lauterbachs Unvollendete, die Krankenhausreform. Hier werden über den im Sommer 2025 startenden – jetzt nicht mehr mit Beitragsgeldern, sondern mit Schulden finanzierten – Krankenhaustransformationsfonds (KHTF) satte 50 Milliarden Euro investiert, um ambulante und stationäre Leistungen stärker zu verzahnen und um das stationäre Versorgungsangebot spürbar zu zentralisieren.
Was in diese Diskussionen mit hineinspielt, sind die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Die sind bekanntlich eine Erfolgsgeschichte, allerdings gibt es auch viel Kritik an zu starker „Kommerzialisierung“ der Versorgung durch investorengetriebene MVZ-Träger. „Politikerinnen und Politiker aller Parteien sehen hier Regulierungsbedarf – eine Diskussion, die weit in die letzte Legislaturperiode und darüber hinaus reicht. Schwarz-Rot will da nicht zurückstehen: „Wir erlassen ein Gesetz zur Regulierung investorenbetriebener Medizinischer Versorgungszentren“ – steht im Koalitionsvertrag. Wann? Unklar. Immerhin: Das Baby hat schon einen Namen: iMVZ-Regulierungsgesetz.
Interview: Von der Technologie- zur Versorgungsperspektive
Die gematik hat mit einer neuen Geschäftsführung während des Regierungswechsels den ePA-Rollout auf den Weg gebracht. Dr. Florian Fuhrmann erläutert im Interview die künftige Arbeitsweise und Ausrichtung der für die Telematikinfrastruktur zuständigen Gesellschaft.
Chaos bei der Telemedizin
Es ist weitgehend unstrittig, dass sowohl Krankenhausreform als auch Primärarztsystem, mit oder ohne investorenbetriebene MVZ, nur dann Erfolgschancen haben, wenn sie mit digitalen Infrastrukturen und Prozessen hinterlegt werden. Bei der Krankenhausreform geht es dabei um Telekonsile, beim Primärarztsystem um Digital-First-Szenarien durch Einsatz von digitalen Assistenzsystemen wie Videosprechstunden und asynchroner Telemedizin. Aus Versorgungssicht ist der Bereich Telemedizin dann auch eine wichtige E-Health-politische Baustelle, die Schwarz-Rot politisch beackern muss. Doch hier herrscht Chaos. Im stationären Bereich enthält die Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung (KHTF) zwar in § 3 Absatz 3 die explizite Aufforderung an die Krankenhäuser, (auch) Anträge auf telemedizinische Netzwerkstrukturen zu stellen.
Gleichzeitig werden Telekonsilnetzwerke dort, wo sie politisch initiiert wurden, aber eher wieder zurückgefahren. Ein Beispiel ist Nordrhein-Westfalen, wo die Landesregierung das lange als Erfolg zelebrierte Virtuelle Krankenhaus ad hoc beerdigte. „Wir sehen die Gefahr, dass das KHTF-Geld für die reine Umgestaltung des Status quo genutzt wird“, sagte Dirk Ruiss vom Verband der Ersatzkassen beim Telemedizinkongress in Berlin. „Vielleicht hilft es, den telemedizinischen Versorgungszweck noch etwas verbindlicher zu machen.“ Matthias Heidmeier, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, hatte dafür offene Ohren: „Wir werden telemedizinische Angebote brauchen, und dazu müssen wir auch an einer besseren Finanzierungslogik arbeiten.“
Plattform-Wars vor dem Sozialgericht
Chaotisch geht es auch im ambulanten Bereich zu. Die Aussicht auf digitale Termin-, Steuerungs- und Videosprechstundenplattformen elektrisiert sowohl das KV-System als auch die Privatwirtschaft – und jetzt auch die Gerichte. Sowohl die KV Bayern als auch die KV Nordrhein haben die Videosprechstundenplattform TeleClinic verklagt. Die hat es mit einem attraktiven Angebot in den letzten zwei Jahren geschafft, im vor sich hin dümpelnden Videosprechstundenmarkt gegen den Trend zu reüssieren. Vor dem Sozialgericht München hat die KV Bayerns am 29. April 2025 ein bemerkenswertes Urteil errungen, in dem der TeleClinic erstinstanzlich und vorerst nur in Bayern eine ganze Reihe von Praktiken untersagt wird.
Dass das in Sachen Videosprechstunden das letzte Wort ist, glaubt exakt niemand in Berlin. Der Tenor ist eher: Das Urteil illustriert den politischen Handlungsbedarf. Tatsächlich grätschte das Bundesgesundheitsministerium den KVen in Sachen Videosprechstunden Anfang Juli gleich mal grob zwischen die Beine. Die erst im April vom Bewertungsausschuss beschlossene Begrenzung der Videosprechstunden für praxisfremde Patienten auf 30 Prozent musste nach massiver Kritik rückgängig gemacht werden. Jetzt gilt eine pauschale 50-Prozent-Quote – egal ob eigener oder neuer Patient.
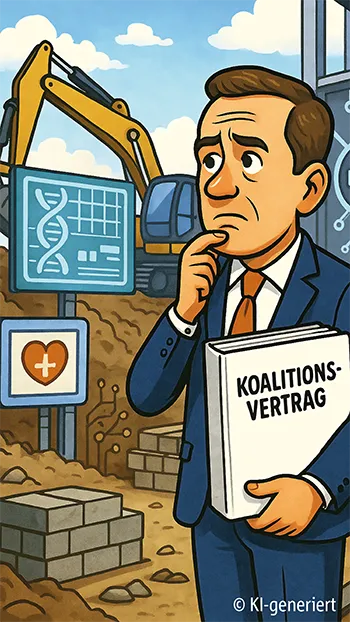
Digitale Versorgung breiter denken
Letztlich, so Jessica Birkmann, Leiterin der Stabsstelle Politik bei medatixx, greife der starke Fokus auf die Videosprechstunde ohnehin zu kurz: „Die entscheidende Frage ist doch nicht, wie viele Videosprechstunden budgetär möglich sind. Die entscheidende Frage ist, wie die Arztpraxen dabei unterstützt werden können, sich digitale Anwendungen aller Art in die Praxis zu holen und sie in die Versorgungsprozesse zu integrieren.“ Die Online-Rezeption (siehe Seite 16) ist hier ein Stichwort. Sie könne den Praxen viel Arbeit abnehmen, so Birkmann, aber finanziell gebe es dafür keine großen Anreize. Auch Telekonsilsysteme, die es erlauben, Teile der fachärztlichen Versorgung in der Hausarztpraxis zu erledigen, wären spannend. Aber auch hier: Es muss sich in irgendeiner Weise rechnen, für alle Beteiligten. Neben passenden Vergütungsmodellen bleibt in diesem Zusammenhang auch eine Investitionsförderung ambulanter Arztpraxen nach dem Vorbild der Krankenhäuser auf der politischen Agenda. Die KBV hat sich eindeutig als Unterstützerin eines „Praxiszukunftsgesetzes“ positioniert, gleichermaßen der Gesundheits-IT-Verband bvitg. Wie viel Gehör das finden wird? Unklar. Steht nämlich nicht im Koalitionsvertrag.
Wie weiter, Telematikinfrastruktur?
Neben der Telemedizin bleibt die Telematikinfrastruktur (TI) ein großes E-Health-politisches Themenfeld. Und da das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) der Hauptgesellschafter der gematik ist, ist jede Entscheidung in diesem Bereich immer auch Gesundheitspolitik. Jenseits der ePA muss es bei den anderen TI-Anwendungen vorangehen, beim TI-Messenger, bei den elektronischen Verordnungen und bei digitalen Versorgungsprozessen aller Art. Die gematik hat dazu eine neue Roadmap konzipiert, und sie will mehr Kompetenz in Sachen medizinischer Versorgung aufbauen, um besser auf Augenhöhe mit den Stakeholdern kommunizieren und entwickeln zu können.
IT-Systeme öffnen, aber richtig
Eine unbeantwortete Frage in Sachen E-Health-Politik ist die nach den genauen Aufgaben der gematik. Diese sollten eigentlich im Gesundheits-Digitalagentur-Gesetz (GDAG) festgezurrt werden. Doch das fiel dem Ampel-Crash zum Opfer. Das BMG von Nina Warken wird hier handeln müssen – wie, ist unklar, steht nämlich nicht im Koalitionsvertrag. Durch das Kompetenzzentrum Interoperabilität im Gesundheitswesen (KIG) hat die „neue“ gematik schon einiges von dem vorweggenommen, was eine Digitalagentur leisten muss. „Als medatixx sehen wir das sehr positiv“, betont Jessica Birkmann. „Das ist mindestens ein Vorläufer einer guten Governance. Aber Rollen und Zuständigkeiten müssen jetzt auch gesetzlich noch mal klar definiert werden.“
Rollen und Zuständigkeiten, das betrifft nicht nur die gematik, sondern den gesamten regulatorischen Komplex, zu dem auch die KBV mit ihren umfassenden Zertifizierungsaufgaben im Bereich Praxis-IT sowie deren zwei Tochterunternehmen, die für strukturierte Datensätze in der ePA zuständige mio42 GmbH und die für ambulante innerärztliche Telematikanwendungen zuständige kv.digital GmbH, gehören. Wer macht was? Und wie wird sichergestellt, dass nicht an unterschiedlichen Stellen digitale Anwendungen vorangetrieben werden, die am Ende nicht zusammenpassen?
Ein Beispiel, das den Abstimmungsbedarf illustriert, ist das Thema Datenaustausch per Praxissoftware. Hier wurde vor Jahren eine Archiv- und Wechselschnittstelle (AWST) politisch initiiert und auch umgesetzt. Die politische Intention: Datenexport und -import aus der Praxis-IT sollten weniger komplex werden, auch um einen Wechsel der Praxis-IT zu vereinfachen. Tatsächlich war die AWST ein großer Reinfall – zum einen, weil sie nur etwa 60 Prozent aller Daten umfasste, die in der ambulanten Versorgung relevant sind, zum anderen, weil die Vorstellung naiv ist, dass der Wechsel einer Praxis-IT nichts anderes sei als der Wechsel von einem alten auf ein neues iPhone. Danach wurde beim InteropCouncil der gematik ein Arbeitskreis ins Leben gerufen, der sich aus verschiedenen Expertinnen und Experten der Praxis-IT-Branche zusammensetzte. In einem gemeinsamen Papier wurde detailliert dargelegt, wie eine Wechselschnittstelle aussehen müsste, die funktioniert. Mit neuem gesetzlichen Auftrag soll jetzt eine neue Wechselschnittstelle – ohne Archiv! – umgesetzt werden, von der mio42 GmbH unter Aufsicht der gematik. Doch plötzlich gibt es Pläne, die Wechselschnittstelle in Richtung einer „Mehrwertschnittstelle“ zu erweitern, bei der keiner genau weiß, was das sein könnte. Kurz und gut: Es bedarf politischer Führung, damit etwas rauskommt, das die ambulante Versorgung weiterbringt – und keine neue Bürokratie produziert.
Weniger Bürokratie ertragen
Stichwort Bürokratieabbau. Auch hier: „Steht doch im Koalitionsvertrag!“ Gibt natürlich auch niemanden, der das schlecht findet. Viel konkreter ist das Thema bisher aber noch nicht. Auch hier kam der Ampel-Crash dazwischen, ein Bürokratieentlastungsgesetz für das Gesundheitswesen blieb eine gute Idee, wurde aber nicht umgesetzt. So könnten Bereiche wie Smart Homecare, Physiotherapie und Pflege von einer erweiterten Abrechnungsmöglichkeit elektronisch signierter Dokumente nach § 302 SGB V deutlich profitieren. Eine konsequentere Durchsetzung elektronischer Leistungsnachweise würde vielerorts Medienbrüche beseitigen.
Mehr Forschung wagen
Last but not least ist die Gesundheitsdatenforschung eines der größten Handlungsfelder digitaler Gesundheits- (und Forschungs-)politik. Hier wird im Koalitionsvertrag sogar ein Gesetz ganz konkret benannt, das Registergesetz. Bei den Registern geht es um eine bessere Auswertung von Daten aus der medizinischen Versorgung. Sie sollen dazu mit Abrechnungsdaten einerseits und ePA-Daten andererseits verknüpft werden, zugänglich gemacht über eine vertrauenswürdige Infrastruktur, bei der dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Schlüsselrolle zukommt. Mit Bezug auf die klinischen Krebsregister steht das so schon im Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Damit das in der ganzen Registerbreite funktioniert, werden allerdings die mehreren hundert klinischen Register in Deutschland fitter gemacht werden müssen – daher das Registergesetz.
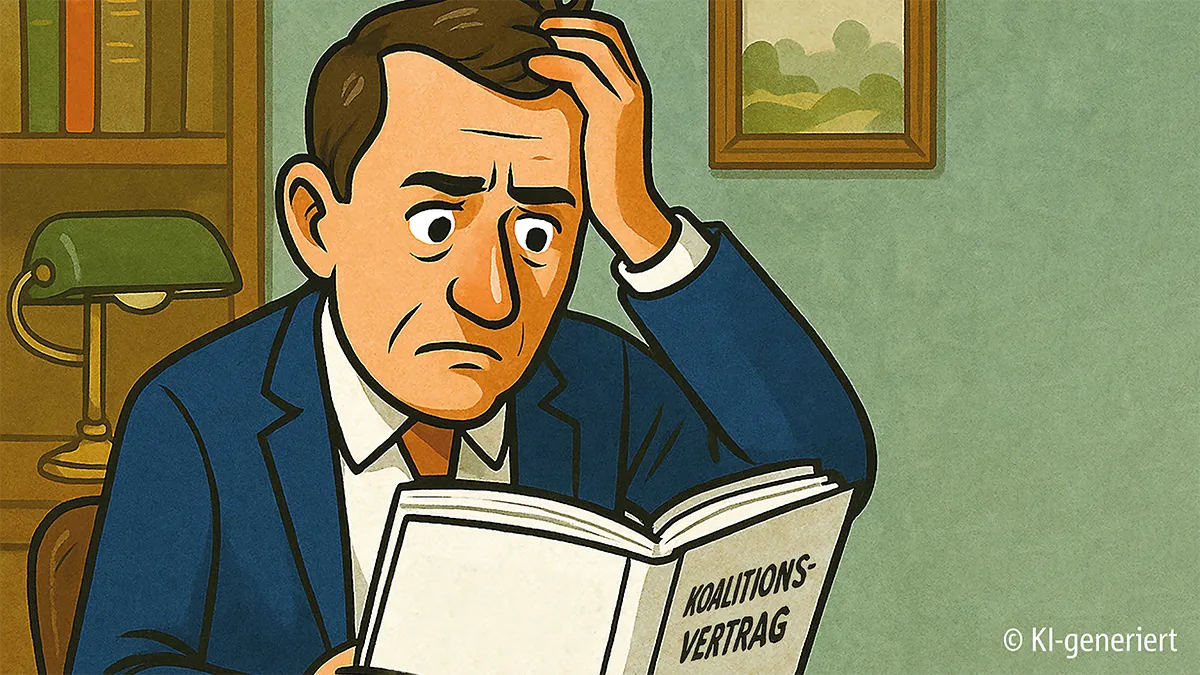
Druck kommt aus Brüssel …
Das Thema Register und Gesundheitsdaten hat noch eine weitere Dimension. Für das BMG ist die um das BfArM herum zentrierte Gesundheitsdateninfrastruktur die deutsche Antwort auf den Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS). Die Vorgängerregierung plante, die gematik zu Deutschlands Digital Health Authority im EHDS zu machen. Das Problem dabei ist, dass der EHDS sowohl Forschung als auch Versorgung adressiert – und dass das politisch in Deutschland weitgehend getrennt ist. Für die Forschung ist das Bundesforschungsministerium zuständig, und da gibt es gleich mehrere digitale Infrastrukturen: die Medizininformatik-Initiative, das Netzwerk Universitätsmedizin und die Nationale Forschungsdateninfrastruktur Gesundheit (NFDI4Health). Schon der gesunde Menschenverstand sagt, dass diese diversen Infrastrukturen kompatibel sein müssen. Dank EHDS gibt es dafür jetzt auch angemessen Druck aus Brüssel. Um das deutsche Gesundheitsdatenwesen EHDS-kompatibel zu machen, wird in Berlin über ein „Gesundheitsdatengesetz 2.0“ diskutiert.
… und von Herrn Hecken
Druck in Sachen digital hinterlegter Gesundheitsdatenforschung kommt aber auch noch von ganz anderer Seite, vom G-BA. Der muss sich mit dem Problem herumschlagen, dass immer mehr teure Arzneimittel bei Zulassung relativ wenig Evidenz mitbringen. Die gesundheitspolitische Idee war bisher, die Evidenz in solchen Fällen über sogenannte anwendungsbegleitende Datenerhebungen zu generieren. Das aber funktioniert hinten und vorne nicht, mit der Folge, dass die Kosten dieser Medikamente – es handelt sich vor allem um Medikamente für seltene Erkrankungen und um Onkologika – explodieren.
Der G-BA-Vorsitzende Professor Josef Hecken würde dieses Problem gern mit – genau – Registern lösen, konkret einem „kollektiven Kohortenmodell“. Dabei würden Real-World-Register von spezialisierten Zentren weitgehend automatisch befüllt, und es gäbe prädefinierte Datenschnitte zu bestimmten Zeitpunkten mit einer ebenfalls weitgehend automatisierten Auswertung von Nutzen und Kosten. Klingt alles ziemlich digital. Da diese „Zentren“, ob bei Krebs oder seltenen Erkrankungen, in der Regel Netzwerke sind und regelmäßig auch Arztpraxen umfassen, wäre die ambulante Welt davon mitbetroffen.
Fazit
Mit ePA, neuer gematik und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz 1.0 hat die Ampelkoalition in Sachen E-Health-Politik Entwicklungen angestoßen, die langsam Früchte tragen. Die schwarz-rote Regierung kann darauf aufsetzen, und sie will das auch. Warten darf sie damit nicht beliebig lang.
Der Artikel erschien erstmals am 23. September 2025 im x.press 25.4.
